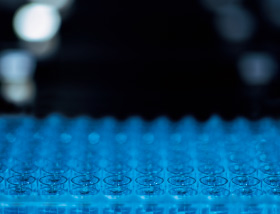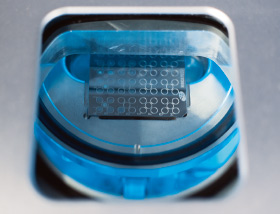Forschen für den Markt.
Wie die Grundlagenforschung zum Geschäftserfolg des Konzerns beiträgt, was Europa als Forschungsstandort auszeichnet und wo es Verbesserungsbedarf gibt – ein Interview mit Dr. Thomas Renner, dem Leiter der WACKER-eigenen Forschungseinrichtung „Consortium für elektrochemische Industrie“.
Forschung und Entwicklung als Erfolgsfaktor schreiben sich viele Unternehmen auf die Fahnen. Was macht WACKER hier anders und besser als seine Wettbewerber?
Dr. Renner: Natürlich machen wir in unserer F+E-Arbeit nicht alles komplett anders als andere Chemieunternehmen. Aber ein paar wichtige Unterscheidungsmerkmale gibt es bei uns schon. Das ist zum Beispiel die sehr konsequente Ausrichtung unserer Forschung auf die wichtigen Zukunftsmärkte, die weltweiten Megatrends. Wir haben uns die Fragen gestellt: Was sind die Herausforderungen von morgen? Und was können wir mit unserem speziellen Know-how dazu beitragen, um hier Lösungen zu liefern? Wir haben erkannt, dass von der Chemie nicht mehr nur Chemikalien erwartet werden. Die Märkte fordern Materialien, also funktionale Werkstoffe, mit definierten Eigenschaftsprofilen zur gezielten Lösung von Problemen. Deshalb entwickeln wir heute keine neuen Chemikalien mehr, um anschließend eine Verwendung für sie zu suchen. Unsere Forschung arbeitet genau andersherum: Wir nehmen Herausforderungen in den Märkten auf, leiten die notwendigen Eigenschaftsprofile ab und entwickeln gezielt neue Materialien auf Basis unserer Kernkompetenzen.
Haben Sie ein Beispiel?
Nehmen Sie das Thema Energiespeicherung. Batterien leistungsfähiger zu machen, ist essenziell für die Weiterentwicklung all der elektronischen Geräte, die mittlerweile zu unserem Alltag gehören – Smartphones zum Beispiel, Tablets und Laptops. Genauso gilt das für die Elektromobilität oder die dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energiequellen. Und Silicium – ein Feld, auf dem WACKER mehr als 50 Jahre Erfahrung hat – ist der leistungsfähigste Speicher für Lithium-Ionen. Deshalb ist die Batterietechnologie ein ganz wichtiges Fokusfeld in unserer Forschung.
Die Konzernforschung von WACKER sitzt in Deutschland, aber 80 Prozent Ihres Umsatzes machen Sie im Ausland. Forschen in Europa für die Wachstumsmärkte in Übersee, wie geht das zusammen?
In unserem Fall sehr gut, denn wir forschen zentral, ohne in der Entwicklungsarbeit auf die Nähe zu den Kunden zu verzichten. Im Consortium, der Keimzelle des Unternehmens und unserer zentralen Forschung, kümmern wir uns um langfristige Projekte und solche, die in Zukunft neue Geschäftsfelder eröffnen sollen. In den Regionen wiederum treiben wir in unseren Technischen Zentren die anwendungsnahe Produktentwicklung gemeinsam mit unseren Kunden voran. So stellen wir sicher, dass wir immer die Rückkopplung zu den Anwendern haben. Zudem bauen wir Kompetenzzentren in solchen Märkten auf, die in bestimmten Technologiefeldern weltweit den Takt vorgeben. In der Elektronik ist das zum Beispiel Südkorea. Deshalb haben wir dort unser Center of Excellence Electronics eingerichtet, das Silicone für Elektronikanwendungen entwickelt. So können wir Technologie- und Markttrends frühzeitig erkennen und zum richtigen Zeitpunkt maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
„Wir brauchen in Europa eine höhere Innovationsgeschwindigkeit.“
Wie bewerten Sie den Forschungsstandort Europa – heute und in Zukunft?
Gerade in Sachen Forschung hat Europa klare Standortvorteile. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine Studie von Oxford Economics, die der Verband der Chemischen Industrie kürzlich veröffentlicht hat. Die chemische Industrie zählt zu den forschungsintensivsten Branchen. Im Jahr 2013 beliefen sich die weltweiten Ausgaben der Chemieindustrie für Forschung und Entwicklung auf 112,2 Milliarden Euro. Davon entfällt mit 26,9 Milliarden Euro fast ein Viertel auf Europa. Eine hohe Forschungsintensität wirkt sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Produkt- und Prozessinnovationen sind ausschlaggebende Faktoren, um Kunden einen Mehrwert zu bieten und Kostennachteile auszugleichen. Unsere wichtigsten Ressourcen in Europa sind Wissen und Bildung. Ein großer Vorteil, den wir in Europa haben, ist das umfangreiche Netzwerk exzellenter, weltweit etablierter Hochschulen und staatlicher Forschungsgesellschaften. Bei WACKER pflegen wir mit der Wissenschafts-Community einen intensiven Austausch und fruchtbare Kooperationen. Mit der Technischen Universität München unterhalten wir gemeinsam das WACKER-Institut für Siliciumchemie, das wichtige Impulse für unsere eigene Forschungsarbeit liefert. Die intensive Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen ist für Europas Wettbewerbsfähigkeit essenziell. Ein weiterer Pluspunkt für Europa sind aus meiner Sicht unsere etablierten Rechtssysteme zum Schutz geistigen Eigentums, die in der Gesellschaft akzeptiert sind. Das ist in manchen anderen Regionen weit weniger der Fall. Aber wir brauchen in Europa eine höhere Innovationsgeschwindigkeit – gute Ideen müssen schneller auf den Markt.
Wie lässt sich das erreichen?
Wir brauchen nicht nur eine noch stärkere internationale Vernetzung, sondern auch eine enge Zusammenarbeit mit den Hochschulen in anwendungsnahen Grundlagenthemen und – ähnlich wie in den USA – ein bewusstes Unternehmertum der Forschungseinrichtungen, das darauf abzielt, wissenschaftliche Erkenntnisse in erfolgreiche Innovationen zu überführen. Davon würde ich mir in Europa mehr wünschen.
„Definierte Projektpläne und Meilensteine, Effizienz und eine messbare Zielerreichung zeichnen unsere anwendungsbezogene Forschung aus.“
Wie misst WACKER den Beitrag zum Geschäftserfolg, den Forschung und Entwicklung leisten? Lässt sich das beziffern?
Ein gutes Projektmanagement ist hier das A und O. Bevor wir Ressourcen in ein Forschungsprojekt stecken, analysieren wir genau, welcher Aufwand dafür erforderlich ist und welches Umsatz- und Ergebnispotenzial wir damit erschließen können. Im Projektverlauf werden Kosten und erwartetes Marktpotenzial laufend nachverfolgt, um nötigenfalls korrigieren zu können. Dass sich dieses systematische Vorgehen auszahlt, zeigt sich auch in unserer Umsatzstruktur: Pro Jahr erwirtschaften wir rund 900 Millionen Euro mit Produkten, die nicht älter sind als fünf Jahre. Das ist etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes.